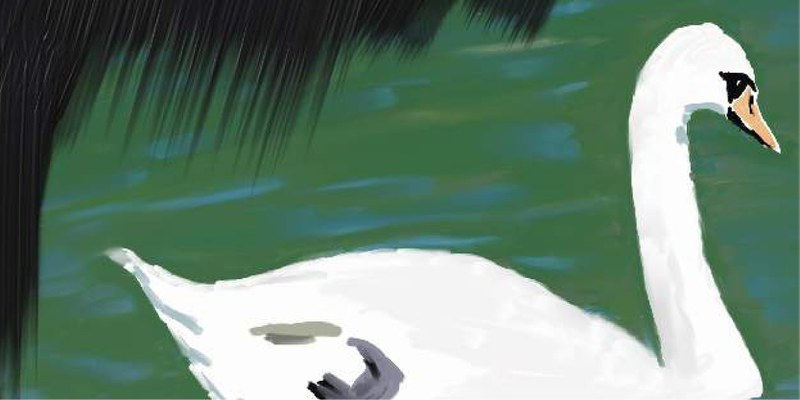
Belletristik
Jean Prod'hom
November
Aus dem Französischen übersetzt von Yves Raeber
Das Buch handelt von einem zehntägigen Spaziergang im Seeland, vom Abschied eines Freundes, vom Inrentegehen, von Leuten, die an der Strecke leben oder gelebt haben, von der Natur, den Tieren und viel Gelesenem. Ein sehr spaziergängerisches und philosophisch-literarisches Buch.
Andere Titel des Verlags bzw. der Autorin/des Autors
- Amori. Die Inseln
- Astronaut unter dem Milchglasdach
- Das geteilte Elektron
- Der Eigentümer des Lapsus
- Der Kälberich
- Der Preis
- Der blaue Faden. Pariser Dunkelziffern
- Die Erde und ihr Trabant
- Die Farben der Schwalbe
- Die Panzerung
- Durch das Westland
- Es war doch nur Sex
- Farantheiner
- Grit
- Heiligenscheinblass
- Hinter dem Gwätt
- Hoch oben im Tal der Wölfe
- Hoffnung und Fest
- Hotel Galaxy
- I will be different every time
- Jeden Tag eine Geschichte
- Kaktus
- Kindergedichte
- Konrad, Felix und ich
- La Catherine
- Lichtschaden. Zement
- Louis Soutter, sehr wahrscheinlich
- Maud und Aud
- Nebelstreif
- Neon Pink Blue
- Schuhmacher
- Sieben Jahre mit dem Japaner
- Teneber Vid
- Versickerungen
- Wiedersehen in Tanger
- Willkommen im Tal der Tränen
- Wo der August ein Herbstmonat ist
Verlagstexte
Jean Prod’hom, ein in der Romandie sehr bekannter Schweizer Autor, durchquert das Dreiseenland mit Rousseau und Walser in der Tasche. Abends schreibt er auf, was er erlebt, geträumt und fantasiert hat. Im Hintergrund spazieren sein sterbender Freund mit, das Ende seiner Erwerbstätigkeit und die Frage, was noch kommen wird. Wir lernen Leute, die an seiner Strecke leben und arbeiten, kennen und erfahren von ihren Plänen. Mit dabei immer die Vergangenheit, die Geschichten darum, was wo und warum früher war.
"Statt in den schlaraffenartigen Süden ging ich einmal mehr in die zu Unrecht unbeliebten Gefilde des Nordens, dorthin, wo die Gegenwart vor sich hin stottert, die Zukunft zögert und die Vergangenheit ewig nachhallt. Jetzt, da ich weiss, wohin mich meine Reise geführt hat, kann ich sagen, das Seeland – Land der Seen und dank eines uralten Widerspruchs auch Land der Seelen – habe sie geleitet."
Textprobe(n)
Es war wohl etwas leichtfertig, keine Gedanken an die Zeit nach meinem Ausscheiden aus dem Berufsleben verschwenden und mich fortan auf das Wesentliche konzentrieren zu wollen: das Haus zu bewirtschaften, das ich mit meiner Frau und meinen Kindern bewohne, sie alle zu lieben und im Blog, den ich seit über zehn Jahren führe, mit kurzen Einträgen täglich daran zu erinnern, dass ich noch am Leben bin und täglich etwas Nennenswertes geschieht.
Und doch sprach weniger für diese Option als jene, im alten Trott weiterzumachen und den einen oder anderen Auftrag anzunehmen, an denen es nicht gemangelt und was mich dazu gezwungen hätte, meinem von inneren Zwängen bestimmten Tagesablauf auch noch äussere hinzuzufügen. Ich war den Spagat satt, der mein ganzes Berufsleben bestimmt und mich mehrmals an den Rand der Erschöpfung gebracht hatte, von der ich mich jeweils notgedrungen, meinen Durst nach etwas Weisheit, der ersehnten Seelenruhe sträflich vernachlässigend, schnell erholte.
Vom Kader des öffentlichen Dienstes ausgemustert zu werden lehrte mich zudem, dass ich trotz meines unablässigen Einsatzes nicht unersetzlich war. Neidlos zuzugestehen, dass ein anderer meine Aufgaben mit vergleichbaren Resultaten und derselben Erfüllung erledigen würde, gab mir die Welt in ihrer vollen Dimension zurück. Beim Abschied schaute ich in den Himmel, dankte allen, die mir in heiklen Unternehmungen zur Seite gestanden hatten und ohne die ich jämmerlich versagt hätte. Meine Zeit war abgelaufen, ich gab meine Schlüssel ab und machte mich, die Hände in den Hosentaschen, auf den Weg.
Schon nach wenigen Tagen wurde mir bewusst, dass mir die Zeit vom Eintritt in die Primarschule bis zu jenem Tag, an dem ich meine dreissigjährige Lehrtätigkeit am Gymnasium beendet hatte, buchstäblich zwischen den Fingern zerronnen war. Und mir erschienen die fünfzig vergangenen Jahre plötzlich wie ein zäher, abgründiger Albtraum, den wir beim Aufwachen erleichtert vergessen. Die detaillierte Erinnerung an mein Berufsleben verblasste, bald wusste ich nur noch wenig davon.
In der Folge hatte ich das seltsame Gefühl, dass sich ein Leben – oder das, was davon bleibt, wenn man ihm Geschwätz und Artigkeiten entzieht – in einem einzigen Satz zusammenfassen lässt. Und ich wollte diesen Satz, den ich als Kind mit einem »ja« begonnen hatte, so, wie ich ihn gespeichert hatte, weiterspinnen, solange es meine Kräfte zuliessen.
Natürlich war ich voller Anerkennung für den Einsatz aller treibenden Kräfte unserer Gesellschaft, für die geistigen Errungenschaften und den technischen Fortschritt: Unsere Lebenserwartung ist gestiegen, Krankheiten sind ausgemerzt und viele Schmerzen zumindest gelindert. Der Mensch ist zum Mond geflogen und auf den Grund der Ozeane getaucht. Doch schafft blinder Fortschrittsglaube auch Ungerechtigkeit, Verlierer und einen bitteren Nachgeschmack.
Mir erschien die mir künftig zur Verfügung stehende, von Beruf und Freizeit ungebundene Zeit als Chance und Pflicht, von der Fortschrittsmaschinerie, deren Teil ich ja gewesen war, Abstand zu nehmen und mich in dieser von uns zwanghaft domestizierten Welt neu zu definieren. Das, was unser Leben in guten wie in schlechten Zeiten beflügelt, nicht mehr zu verdrängen, dieses Namenlose, das wir anflehen, wenn wir nach einer verlorenen Partie mittellos und verzweifelt dastehen, und lobpreisen, wenn alles nach Wunsch läuft.
Rückzug aus der Welt also und ihren allzu weltlichen Geschäften und sich mit ihr, einer rätselhaften Umkehrung wegen, zugleich verbundener fühlen als je zuvor. Am Morgen aufstehen wie ein Kind, ohne die am Vorabend ausgeklügelten Winkelzüge umsetzen zu müssen, sich statt auf einem Schachbrett über ein abenteuerliches Himmel-und-Hölle-Feld bewegen.
Ganz so lief es dann nicht, doch wuchs meine Naivität über meine Zaghaftigkeit hinaus und führte mich tatsächlich an einen Ort, von dem ich nicht einmal zu träumen gewagt hätte.
*
Wer weiss, was mir der November beschert hätte, wenn nicht Ende Oktober etwas vorgefallen wäre, das die darauffolgenden Tage und Monate auf ganz besondere Weise beeinflussen sollte.
Wie ich es seit mehreren Jahren zu tun pflegte, begab ich mich nach Chantemerle, in eine dieser heutzutage immer zahlreicheren Altersresidenzen. Das Anwesen ist herrlich gelegen, mitten auf einer Lichtung am linken Ufer der Broye, das weitläufige Gelände erstreckt sich bis zu einem Laubwald am Fuss eines von Fichten und Tannen überwachsenen Hügels. Das stattliche Haus war im 19. Jahrhundert Sitz einer Firma gewesen, deren Namen mit der Industrialisierung der Milchpulver- und Kondensmilch-Produktion eng verbunden ist. Heute bietet es Platz für etwa zwanzig Bewohner. Etwas weiter unten, wo Ende des 20. Jahrhunderts die Fabrik stand, befinden sich nun Wirtschaftsgebäude, ein von den Bewohnern geführtes Café und Stallungen.
Im geräumigen Park dieses freundlichen und von seinen Dimensionen her durchaus menschlichen Alters- und Pflegeheims kann man sich frei bewegen. Rehe leben friedlich mit Lamas, Ziegen, Pferden, Hühnern und Gänsen zusammen. Familien freuen sich über den Spielplatz, der Ort ist zu einem begehrten Ausflugsziel für Tagesschulreisen geworden.
Wegen Arthur, ein alter Mann, dem das Leben wenig geschenkt hatte, war mir das Haus vertraut. Er war nach dem Tod seiner Mutter verdingt worden, hatte als Fuhrmann und später als Bauernknecht gearbeitet. Mehr als einmal war er am Verdingmarkt in Moudon zu besehen gewesen. Ich hatte ihn per Zufall kennengelernt, er wohnte damals noch in Villars-Mendraz.
Für jeden Bauernknecht kommt einmal der Tag, an dem er es nicht mehr schafft, ein Pferd aufzuzäumen oder andere bescheidene Aufgaben auszuführen, und so landete Arthur eines Tages in Chantemerle.
Er war ein wortkarger Zeitgenosse. Ich besuchte ihn jeweils am Samstagvormittag, wir sassen im Wintergarten und tranken Tee. Dann rauchte Arthur eine Zigarre und wir spielten Karten. Er wiederholte unablässig: »Chantemerle ist das Haus des lieben Gottes!«
Arthur starb im Januar 2016. Wegen eines anderen Bewohners, den ich kennengelernt hatte, als ich noch Arthur besuchte, ging ich aber weiterhin nach Chantemerle.
S. war ein bald achtzigjähriger, zurückgezogener und diskreter Mann, der mir rasch ans Herz wuchs, jemand, der sich mit wenig zufriedengab. Er lebte seit zwei Jahren in Chantemerle und hielt sich täglich auf der Veranda auf. Er sass dann mit einem Glas Wasser oder einer Tasse Grüntee vor einem Buch, aus dem er ab und zu ein paar Zeilen las, und betrachtete ausgiebig den Garten.
Dieser alte Mann schien keine Bedürfnisse zu haben. Er war immer sauber gekleidet, auch wenn er ausser mir und der Hauskatze keinen Besuch erwartete. Ich war nur ein einziges Mal in seinem Zimmer, warum habe ich vergessen. Es glich einer Mönchszelle, an der Wand hing ein einziges Bild, eine Reproduktion des Heiligen Augustinus von Vittore Carpaccio aus der Scuola San Giorgio degli Schiavoni in Venedig.
Einmal erzählte er mir ein bisschen zurückhaltend seine Lebensgeschichte, er wollte die Vergangenheit nicht strapazieren.
Er war aus gutem Haus und hatte sich nach einem ausführlichen Studium ganz der Medizinforschung gewidmet. Bis weit über das Rentenalter hinaus hatte er an der Universität wichtige Ämter inne. Er vertraute mir an, dass er in diesem derart fordernden Beruf die Vorstellung, sein Leben mit jemandem zu teilen, schnell aufgegeben habe und der stetigen Konzentration wegen sogar den Tod vergessen hätte, doch habe sich ihm glücklicherweise seine Gesundheit in Erinnerung gerufen.
In der Folge wandte er sich von allen beruflichen Belangen ab und zog von der Villa in einem vornehmen Lausanner Stadtviertel in eine kleine Wohnung in der Innenstadt. Er lebte fortan ein ungebundenes Leben, widmete sich ganz dem, was Jean-Christophe Bailly eine Zeit ohne Anstellung nennt, eine Zeit, die ihm gar keine andere Wahl liess, als sich ganz mit sich selbst und der Welt zu beschäftigen. So verbrachte er zehn geruhsame Jahre. Als er seiner körperlichen Verfassung wegen nicht mehr allein leben konnte und auch keine Besserung zu erwarten war, machte er sich auf die Suche nach einer Bleibe ausserhalb der Stadt.
S. hatte mich beauftragt, ihm ein bisschen Lektüre zu beschaffen und die Bücher auch wieder zurückzunehmen. Wir sprachen nur wenig über das, was er las. Jeden Samstagvormittag tranken wir Tee im Wintergarten, ohne vom anderen mehr erfahren zu wollen. Was für ihn ein Grund gewesen sein mag, mit mir Freundschaft zu schliessen. Ich bewunderte seine Fähigkeit, sich mit dem Alltäglichen zu begnügen und eine Haltung gefunden zu haben, die ihn aus sicherer Entfernung an der Welt teilhaben liess.
Seine Pflegerin Anna begleitete ihn intensiv. An einem Samstag Ende Oktober informierte sie mich, dass die Krankheit Anfang der Woche plötzlich ausgebrochen war. Sein Gesundheitszustand habe sich verschlechtert und würde es noch weiter tun. Da die Schmerzmittel wirkten, litt er nicht, doch seine Tage waren gezählt.
Mein Freund setzte sich zu mir in den Wintergarten, er gab mir die Bücher zurück und wollte keine neuen mehr. Verunsichert und gestelzt fragte ich, ob ich etwas für ihn tun könne. Zum Garten blickend antwortete er, er wolle lieber von niemandem gestört werden. Seine wenigen Kräfte sollten nicht daran vergeudet werden, Lebende zu trösten, er wollte auch mit dem Irrglauben brechen, ein verlorenes Spiel sei noch nicht ausgespielt. Er behauptete, ich hätte bestimmt Sinnvolleres zu tun, als mich um ihn zu kümmern.
Ich blieb bei S., bis ich spürte, dass das letzte Wort gesprochen war. Dann ging ich. Das Leben kann erstaunlich brutal sein. In der Cafeteria beruhigte mich Anna: Ich könne auf sie zählen, sie würde mich informieren, wenn es so weit sei. Dem gab es nichts anzufügen und ich kehrte ins Riau zurück.
In der folgenden Nacht schlief ich nur wenig, ich musste an die letzten Worte von S. denken und an die bevorstehenden schwierigen Tage. Wenn er sich von mir nicht beistehen liess, würde auch ich auf seinen Trost verzichten müssen. Und so folgte ich seinem Wunsch, mich von ihm zu entfernen, vielleicht in der Hoffnung, mich damit weniger ihm und dem mir abstrakt erscheinenden Tod als vielmehr der Welt zu nähern, die er nun verlassen würde. Es wäre an mir, S. zu begleiten, ohne ihn zu stören, und seinem Anspruch, wenn möglich, in nichts nachzustehen. Ich weihte meine Frau ein, Sandra zeigte für meine Entscheidung grosszügiges Verständnis.
Ohne es zu erschüttern, lenkte diese Situation mein zum Sommerbeginn geplantes Vorhaben in eine neue Richtung, verlieh ihm grössere Dringlichkeit und Tragweite. Der bevorstehende Tod meines Freundes forderte mich auf, mir nichts vorzumachen und aufzubrechen. Und er liess mich kurz den unausweichlichen Augenblick erahnen, in dem ich selbst mein Bündel schnüren und mich mit dem Sterben abfinden müsste.
-
November
Roman / Novelle
-
ALS BUCH:
Hardcover
288 Seiten
Format: k. A.
Auslieferung: ab 25. September 2021
D: 27,00 Euro A: k. A. CH: 29,00 CHF
ISBN (Print) 978-3-03867-038-4
-
Unter der Voraussetzung, dass Sie sich bei uns als professionelle(r) Nutzer(in) registriert haben, können Sie Ihr persönliches REZENSIONSEXEMPLAR durch einen Klick auf den Button „Download“ herunterladen.
 DOWNLOAD
DOWNLOAD
-
Die Autorin bzw. der Autor im Netz:
-
Der Verlag im Netz:
-
Pressekontakt des Verlages:
Ursi Anna Aeschbacher
+41 (0)32 3233631
aeschbacher(at)diebrotsuppe.ch
-
Vertriebskontakt des Verlages:
Ursi Anna Aeschbacher
+41 (0)32 3233631
aeschbacher(at)diebrotsuppe.ch



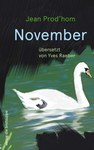



Artikelaktionen